Der Gastbeitrag erscheint im Rahmen der Kultur-Blogparade 2013. Die Restauratorin Marion Biesalski stellt ihr laufendes Projekt für die Bayerische Schlösserverwaltung vor. Wir wünschen viel Lesevergnügen!
Ein finsterer Geselle liegt in verkrampfter Haltung auf dem Werktisch, wirres schwarzes Haar umrahmt sein Gesicht, in den dunkel geränderten, gebrochenen Augen liegt ein Nachhall der erlittenen Qual. Der Anblick des Echthaarkruzifixes erschreckt noch heute jeden unvorbereiteten Besucher unserer Restaurierungswerkstatt.Wie mag seine Wirkung vor 500 Jahren gewesen sein? Eine dicke Schmutzschicht über Haut und Haar verstärkt den unheimlichen Eindruck. Doch damit nicht genug:Ein unbedarfter Mensch hat sich irgendwann an der Reinigung versucht, dabei höchst unglücklich agiert und ein großes helles Rechteck auf der Brust herausgeputzt.
Eine weit verbreitete romantische Vorstellung von unserem Berufsbild vermutet im Restaurator einen Schöngeist, der sein Leben ausschließlich der Ästhetik widmet. Das Ergebnis seiner geduldigen und kunstreichen Bemühungen ist ein „Strahlen“ in wahlweise „altem“ oder auch „neuem Glanze“. Was bedeutet das für die Erwartungen an unser Echthaarkruzifix? Ein Inkarnat weiß wie Schnee, Lippen rot wie Blut und frisch gewaschene und ondulierte Locken, schwarz wie Ebenholz?
Gehen wir der Reihe nach vor:
Zuerst muss der gröbste Schmutz beseitigt werden. Bewaffnet mit Mundschutz, Pinsel und Staubsauger werden die losen Verschmutzungen abgenommen, aus den Haaren mit Hilfe von einer Pinzette ganze Nester von verbackenen Flusen entfernt.
Wenn sich der Blick aufs Objekt etwas geklärt hat, beginnen umfangreiche Untersuchungen. Denn: Bevor der Restaurator restauriert, sollte er wissen, wie das Kunstwerk von seinem Schöpfer wohl einmal gedacht war, welche Zutaten aus späterer Zeit stammen, wie sich die Materialen durch Alterung verändert haben und durch welche Umstände Schäden entstanden sind. Erst dann kann beurteilt werden, welche Maßnahmen in Frage kommen, um das Kunstwerk zu erhalten und womöglich tatsächlich ästhetisch aufzuwerten.
Weiß wie Schnee und rot wie Blut? Nein, das funktioniert leider nicht. Ein Teil des finsteren Eindrucks stammt tatsächlich von einer Verrußung, die irgendwann wohl sogar absichtlich aufgebracht worden ist. Diese Verrußung können wir reduzieren. Darunter liegt eine bräunliche Leim- oder Eiweißschicht, die als Überzug zur letzten Bemalung gehört. Sie gehört für uns zum Kunstwerk und wird belassen. Sie ist übrigens sehr leicht mit einer simplen Alkohol-Wasser-Mischung anzulösen, was zu dem oben erwähnten Reinigungsunfall geführt hat. (Glasreiniger – schafft im Nu streifenfreien Glanz! Aber das ist eben nicht immer erwünscht.)

Der Kruzifix wird für die Restaurierung „gebettet“ – die Rußschicht wird entfernt, der proteinhaltige Überzug bleibt.
Und schwarz wie Ebenholz? Ja, das geht! Allerdings: Allzu brüchig sind die Haare, man darf sie nicht überstrapazieren, eine sanfte Trockenreinigung muss genügen (siehe oben). Übrigens handelt es sich um das Schweifhaar eines Pferdes, das hat ein Wissenschaftler vom Bayerischen Landeskriminalamt untersucht, es ist tatsächlich schwarz gefärbt und in dicken Strähnen zu Locken verzwirbelt.
Die Arbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen, eine Endzustandsaufnahme müssen wir hier erst mal noch schuldig bleiben. Wer aber neugierig geworden ist und mehr über die Restaurierung des Echthaarkruzifixes und die technischen Details erfahren möchte, der sei auf die Web-Site der Bayerischen Schlösserverwaltung hingewiesen, wo nach Abschluss der Restaurierung eine Film- und Foto-gestützte Dokumentation erscheinen wird.




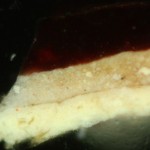



5 Kommentare