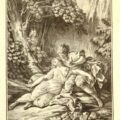Eine große Freude innerhalb der Museumsarbeit und im täglichen Umgang mit den ausgestellten Kunstwerken ist es, Geschichten erzählen zu dürfen: Geschichten von den Menschen, die solch faszinierende und schöne Objekte einst schufen, von ihrem Leben und den Zeitumständen, die dazu führten, dass ein bestimmtes Kunstobjekt in dieser Form, in diesem historischen Moment und zu diesem oder jenem Zweck entstand. Oder aber: Die meist alten Geschichten in Erinnerung zu rufen, die dargestellt sind! Beides miteinander zu vereinen, ist natürlich das Größte!
Denn Viele kennen das: Den Inhalt des Dargestellten vor dem geistigen Auge genießt man mit dem sehenden erst recht die Kreativität, manchmal den Witz, mit denen Stoffe aus Bibel und antiker Mythologie, Szenen aus vergangenem Alltag oder aus dem Bereich der Allegorie (also politische oder philosophische Sujets in symbolischer Verkleidung) zum Leben erweckt werden – sei es auf Leinwand oder Papier, in Bronze, Edelmetall, Stein und Holz, mit Stuckmasse oder mittels farbiger Seidenfäden!

Darauf baut alles auf… – Sündenfall-Darstellung am Sockel des Hausaltars Albrechts V. in der Schatzkammer, c. 1573/74
Und oft handelt es sich auch sowieso um wohlbekannte Themen: Zwei nackte Menschen zu Seiten eines Baums, den ein fieses Reptil umringelt, während allerlei Getier umhertollt, werden auch die nicht gänzlich Bibelfesten unter uns wohl mit der frühesten Erzählung von Crime und Sex verbinden: Mit dem Apfeldiebstahl Adams und Evas und ihrer anschließenden gegenseitigen „Erkenntnis“, der sich das Menschengeschlecht verdankt – die allererste Geschichte mithin, welche die Voraussetzung für den Fortlauf aller weiteren Historie(n) schafft…
Allerdings: Es gibt auch Erzählungen, die zwar unsere Vorfahren so sicher am Schnürchen hatten, wie heutige Jung-LeserInnen die Schulgeheimnisse in Harry Potters Hogwarts-Internat. Uns Spätgeborenen aber bleiben sie so rätselhaft wie die KI-übersetzte Bedienungsanleitung eines koreanischen Haushaltsgeräts.
Hier nun setzt so manche detektivische Spürarbeit einer Museums-Crew an, die meist im Depot über viel Vergleichsmaterial und im Handapparat über meterweise Nachschlagewerke verfügt. Trotzdem – manchmal braucht es nicht nur Eifer, sondern auch Glück, um ein bislang noch gar nicht oder falsch gedeutetes Motiv zu enträtseln und einem Kunstwerk anhand eines lang übersehenen Details „seine“ Geschichte (zurück) zu geben. 
Bei den Verdächtigen handelte es sich um zwei Miniaturen aus dem frühen 18. Jahrhundert in der Sammlung der Residenz, die Kurfürst Max Emanuel (reg. 1679-1726) zusammen mit zahlreichen weiteren Kleingemälden bei dem Brüsseler Maler François Bouly in Auftrag gab.

Max Emanuel, der – nicht immer – siegreiche Feldherr, Miniatur in der Residenzsammlung, C. F. Bruni zugeschrieben, Ende 18. Jh.
In den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts schuf Bouly für den kunst- und sammelbegeisterten Wittelsbacher, der damals als Gouverneur das heutige Belgien regierte, kleinformatige Kopien nach Meisterwerken in Max Emanuels rasch wachsender Gemäldekollektion, die vielleicht als eine Art transportable Bildergalerie dienten. Daneben entstanden galante Szenen mit Göttinnen, Bachantinnen und Meeresnymphen. Mit samtigem Pinsel wurde hier dem auch in puncto Erotik von Sammellust getriebenen Kurfürsten viel nacktes Frauenfleisch präsentiert, dem höchstens seine „mythologische Gewandung“ als Verhüllung diente (denn das Label „Mythologie“ erlaubte in der Kunst von jeher Textilfreiheit).

niemals war ein Bildtitel gleichgültiger… – „Die Meeresnymphe Thetis“, Miniatur von Bouly, um 1703/10
Zwei dieser Szenen Boulys weisen die gleichen Bildprotagonisten auf, weshalb sie offensichtlich als Pendants zusammengehören: einen als Jäger ausstaffierten Jüngling, eine klassische Schönheit im Wolfspelz und einen älteren Mann – dazu ein Liebesengel.
Abseits dieser Erkenntnis bestand jedoch bezüglich des konkreten Inhalts der beiden Darstellungen eben schon sehr früh, nämlich bereits in den ersten erhaltenen Gemäldeinventaren der Residenz aus den 1770er Jahren, schlecht kaschierte Ratlosigkeit, die seitdem nie verflogen ist. Die darin verzeichneten Bildtitel für die damals im Rokoko-Kabinett der Reichen Zimmer befindlichen Miniaturen: „Die verliebte Venus bey ihren geliebten Adonis befindlich, welcher mit einem Hunde scherzet“ und „Die betrübte Venus über den Tod ihres geliebten Adonis“ beziehen sich auf eine der klassischen Verwandlungssagen in Ovids „Metamorphosen“. Allerdings pass(t)en sie damals wie heute nicht recht mit den Einzelheiten der Bilddarstellungen zusammen. Schade für die damaligen Bilderklärer wie für uns – denn erfahrungsgemäß ist eigentlich der Hinweis auf Ovid bei mythologisierender Renaissance- und Barockmalerei in 90 von 100 Fällen eine sichere Bank. Gerade die tragische Liebesgeschichte der Schönheitsgöttin Venus mit dem attraktiven, leider rasch tödlich verunfallten Jäger Adonis wurde vielfach von Tizian bis Rubens rauf und runter gemalt, gemeißelt und gezeichnet.

zeitloser Dauerbrenner: Rokoko-Darstellung der um Adonis klagenden Venus in Stuck von Franz Jacob Vogel in Schloss Seehof, nach 1750
Manches scheint sich tatsächlich zu fügen: So berichtet der altrömische Dichter mit gotteslästerlichem Augenzwinkern, wie die schöne, in der freien Natur aber eher unbeholfene Schutzherrin der Liebe keuchend mit Pfeil und Bogen durch die Wälder hetzt, um – selbst verliebt – dem angebeteten Sterblichen zu imponieren. Von einem Wolfsfell um ihre Taille erwähnt Ovid in seinen Versen hingegen nichts. Wer der ältere Gefolgsmann sein soll, bleibt gleichfalls ungeklärt. Ist es ein Jagdgefährte des Adonis oder gar Venus‘ illusionsloser Ehemann Vulkan?? Und dass sich der Galan mehr mit seinem Jagdhund als der Herrin der Schönheit beschäftigt, steht gleichfalls nicht in den „Metamorphosen“.
Also ist die Spur in den älteren Inventaren wohl eher kalt. Auf der Suche nach größerer Übereinstimmung durchblättert man seinen Ovid weiter und stößt mit Glück im siebten Buch auf die Erzählung des Jägers Cephalus und seiner schönen Gattin Procris. Sie schildert ein klassisches Eifersuchtsdrama: In dessen Verlauf überreicht die stets misstrauische Procris ihrem untreu gewähnten Gemahl als Versöhnungsgeschenke einen stets unfehlbar treffenden Speer (oder Pfeil) sowie den Hund Lailaps, die unübertrefflichste Spürnase die je auf mythologischen Pfaden hechelte (und die ihre Erdenlaufbahn als Sternbild „Großer Hund“ oder „Canis maior“ beendete). Unser ungewöhnliches Motiv des beschmusten Jagdhundes hätten wir also mit etwas gutem Willen untergebracht.
Und auch die niedergesunkene Schönheit auf Miniatur Nr. 2 passt in die Geschichte, denn im weiteren Verlauf, erzählt Ovid, ersticht der offensichtlich kurzsichtige Cephalus aus Versehen die ihm liebestoll nachgeeilte Gattin mit der Zauberwaffe, weil er sie aus der Entfernung für ein Stück Wild hält: „Ach sie sank, und es flohn mit dem Blut die wenigen Kräfte./ Und so lange zu schaun sie vermag; mich schaut sie, und in mich/ Fließt die bekümmerte Seel‘, in meine Lippen geatmet“ klagt der unschuldige Mörder.
Richtig gut geht das mit Boulys Darstellung leider immer noch nicht zusammen. Aber trotzdem, und obwohl wir die dritte Bildfigur damit immer noch nicht passend „verräumt“ haben, sind wir bislang davon ausgegangen, dass es sich bei unseren Miniaturen um Darstellungen des „Cephalus und Procris“-Stoffes handelt, vielleicht bereichert um eine Ovid noch unbekannte Nebenperson, die einer zeitgenössischen Bearbeitung des unglücklichen Liebesabenteuers auf der barocken Opernbühne entnommen wurde? Schließlich waren solch modernen Ausschmückungen mythologischer Kernhandlungen im 17. und 18. Jahrhundert gang und gäbe.
Tatsächlich erweist sich, wie so oft, die Ausweitung des Blicks auf den zeitgenössischen Kontext des hinterfragten Kunstwerks als förderlich beim schlussendlichen Rätselknacken: Denn schließlich war der Auftraggeber Max Emanuel nicht nur Kunst- und Frauenliebhaber sowie als Produkt frühneuzeitlicher Prinzen-Erziehung mit der griechisch-römischen Mythologie wohlvertraut. Sondern er war auch in vielerlei Hinsicht der Sohn seiner Mutter, der ebenso berühmten wie schillernden Kurfürstin Henriette Adelaide (1636-1676).

Lust auf den großen Auftritt: Henriette Adelaide mit einem kleinen Bruder Max Emanuels in der anspruchsvollen Rolle der Gottesmutter persönlich, Miniatur von Michael Scharner in der Residenzsammlung
Diese geborene Prinzessin von Savoyen war an einen Hof aufgewachsen, der von Italien, Frankreich (und Spanien) gleichermaßen beeinflusst wurde und an dem die Literatur, Fest- und Theaterkultur des Barocks deshalb die abenteuerlichsten Blüten hervorbrachte. Henriette Adelaide hat ihrem vergötterten ältesten Sohn vermutlich nicht nur seine lebenslange Begeisterung für die spektakuläre Wunderwelt der Oper eingepflanzt, die sich in Max Emanuels kostspieligem Unterhalt höfischer Musiktheater in München und später in Brüssel manifestieren sollte. Vielleicht hat sie ihm auch ihr Interesse für die vielbändigen barocken Liebesromane vererbt, für die sie ebenso wie ihr berühmter Cousin Louis XIV. von Frankreich, Max Emanuels großes Vorbild in Sachen Lebensstil, schwärmte.
Diese auch als Bühnenstücke adaptierten und im 17. Jahrhundert allgegenwärtigen „Hirtenromane“ oder „Pastoralen“ spielen, wie der Namen schon sagt, in einer mythologischen Schäfergesellschaft, die ein idyllisches Arkadien bewohnt, wo Männlein und Weiblein, von ihren frisch ondulierten, wolligen Lämmchen begleitet, sorglos leben. Es ist ein paradiesischer Sehnsuchtsort, konzipiert als literarischer Gegenentwurf zur starren, hierarchischen Welt der Höfe: Statt Karriere, Protokoll und strategische Heiratspolitik behelligen dort den „Berger“ und seine „Bergère“ – Lysandre, Clorise, Celadon, Fiordiligi, oder wie sie auch immer heißen mögen – nur ihre (allerdings allgegenwärtigen) amourösen Sorgen.

Ganze Kunstsparten wären ohne die höfische Faszination für die „simple Pastorey“ nicht denkbar – etwa die Porzellanskulptur des 18. Jh. – Beispiele aus der Nymphenburger Manufaktur in der Residenzsammlung
Dennoch nehmen es diese Pastoralen, klassische Produkte der sogenannten „preziösen Literatur“, in Buchform an Umfang spielend mit allen russischen Romanen des 19. Jahrhunderts auf, lassen diese aber, was Krieg und Frieden, Schuld und Sühne, Anzahl der handelnden Personen, der Intrigen, Verwicklungen, Liebesverhältnisse und ihre Auflösung betrifft, locker hinter sich. Wohl nicht zuletzt aus diesem Grund sind jene verwirrenden Riesenwälzer mit ihren Heerscharen verliebter Hirten, eifersüchtiger Nymphen, tugendhafter Krieger und entsagungsvoller Prinzessinnen heute außerhalb einer eng umgrenzten Fachwelt nahezu unbekannt.
Hingegen haben Henriette Adelaide und ihr Ältester sicher noch die „Mutter aller pastoralen Schwarten“, gewissermaßen das Ursprungswerk dieses literarischen Genres, gekannt und verehrt: „Il pastor fido“, der „getreue Schäfer“, eine fünfaktige „tragicomedia pastorale“, die Giovan Battista Guarini 1580/83 verfasste und die 1585 zur Hochzeit von Henriette Adelaides Großvater, Karl Emanuel von Savoyen, in Turin uraufgeführt worden war. Seit damals und der kurz darauf erfolgten Drucklegung 1590 in Venedig hatte der „Pastor fido“ in zahllosen Bearbeitungen, Vertonungen und Abwandlungen ein nahezu ewiges Leben erlangt (angeblich nahmen die Damen lieber das Buch statt des Breviers mit in die Messe)! 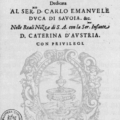
Der aus moderner Sicht – sagen wir mal vorsichtig – seichte, dafür verwirrende Inhalt des „Treuen Schäfers“ hätte gewiss auch heute noch Potential für eine vormittägliche Telenovela im Privatfernsehen. Als Nacherzählung sprengt er aber den Rahmen eines Blogbeitrags zur (gemalten) Kleinkunst deutlich. Interessant für uns ist sowieso nur eine Nebenhandlung, die der etwas stolperigen Liebe des Jägers und (anfänglichen) Frauenverächters Silvio zur schönen Dorinda gewidmet ist: Die beiden kommen sich erstmals näher, als Silvios Hund Melampo ausbüchst und Dorinda und ihrem Diener zuläuft. Den Kuss, den die Schöne als Finderlohn für den Vierbeiner begehrt, bekommt allerdings Melampo aufgedrückt. Ein paar tausend Verse später schleicht Dorinda, von ihrem ältlichen Beschützer begleitet, Silvio auf der Jagd nach und tarnt sich dafür mit einem Wolfsfell (warum und wieso hat zwar alles Gründe, die aber nur auf einer Renaissance-Bühne Plausibilität beanspruchen können – ich sage nur: „Shakespeare-Komödien“….). Silvio hält sie – hier ist Guarinis Anleihe beim Mythos von Cephalus und Procris ganz eng – für Beute und verwundet sie mit einem Pfeil. Als er den Irrtum bemerkt, muss er sich vom alten Linco einiges anhören und will sich, ganz barocker Held, zunächst selbst entleiben. Er wird dann noch an der Unfallstelle von der zum Glück nur leicht verletzten (und im metrischen Redefluss unbeeinträchtigten) Dorinda aus der stabilen Seitenlage heraus zum Weiterleben und Eheversprechen überredet. Während auf der Haupthandlungsebene der „Pastor Fido“ Mirtillo noch einen ganzen Akt lang um die schöne Amarilli lieb-leidet, haben wir so schon bei minimalem Blutverlust ein vollgültiges Happy End zu verzeichnen – ein doppeltes sogar, denn mit dem Duo Silvio-Dorinda ist auch das Sujet unseres Miniaturenpaars endlich nach zahlreichen Missverständnissen und Verwechslungskomödien glücklich identifiziert!

So kommt alles zusammen: denn in Brüssel hielt ja auch seit 1692 Max Emanuel als Statthalter des spanischen Königs Hof. Und eine illustrierte Prunkausgabe des beliebten Theaterstücks machte dort gleichfalls Sinn: Schließlich initiierte der Wittelsbacher in seiner neuen Residenzstadt im Jahr 1700 die Errichtung eines prächtigen Opernhauses (Vorgängerbau des heutzutage wohlbekannten „Théâtre de la Monnaie“), wo er etwa die berühmte Pastoraloper „Acis et Galathée“ von Jean-Bapiste Lully, dem Musikintendanten Ludwigs XIV., aufführen ließ. Die barocke Theaterkultur, der Theaterfan und Bildersammler Max Emanuel – und die Künstler Bouly und van Orley, wirkten in ihrer Faszination für den „Pastor fido“ zusammen: Man darf also annehmen, dass Bouly die Vorzeichnung Richard van Orleys für seinen Textbuch-Kupferstich in eine farbige Miniatur für Max Emanuel umgesetzt und dann noch mit einer weiteren, selbst komponierten Bildszene ergänzt hat (denn van Orleys Vorzeichnung der Auffindung Dorindas unterscheidet sich von der Residenz-Miniatur).
So ist aus unserer fragwürdigen Venus im 1770er-Gemäldeinventar schließlich eine selbstbewusste Nymphe und aus dem schlecht passenden Cephalus ein stolzer Hundebesitzer Silvio geworden! Und unsere Miniaturensammlung hat sich bereichert um eine weitere, uns bislang unbekannte Geschichte über treue Schäfer, bayerische Statthalter, gemalte Theaterstücke und die Gefahr von Schusswaffen in den Händen von Jugendlichen!