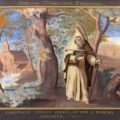In diesen Tagen ziehen wir uns mal minder (meist aber mehr) unfreiwillig in die organisierte Einsamkeit zurück und erliegen den Verlockungen der Welt da draußen höchstens vermittelt über Internet und Shopping-Portale. Der Frust, dass man die menschliche Gesellschaft tunlichst fliehen soll und sich auf sich selbst zurückgeworfen sieht, lässt vergessen, dass genau diese Beschränkungen jahrhundertelang auch immer wieder propagiert wurden und als die letztlich besten, der eigenen Vollendung dienenden Wege persönlicher Lebensführung gegolten haben! Genau daran erinnert in der 2018 neu eröffneten Miniaturensammlung des Residenzmuseums ein kurioses Kompositum von rund vierzig kleinformatigen Gouachen (Malerei mit Deckfarben auf Pergament): Sie zeigen Einsiedler und Eremiten beiderlei Geschlechts in ihren aus Rinde und Weidengeflecht provisorisch errichteten Klausen und Kapellen oder vor abgelegenen Höhlen, in die sie sich zu Gebet und Meditation zurückgezogen haben.
Die Kirchengeschichte erzählt (wenn auch mitunter selbst an recht unzugänglichen Stellen) stolz von der vorbildlichen christlichen Askese dieser Eremiten, ihrem konsequenten Rückzug aus der Welt und ihrer aus Glaubensstärke erwachsenen Wunderkraft, mit der die heiligen Eigenbrötler in der selbst gewählten Isolation gegen diverse (meist fleischliche) Versuchungen des Satans fochten. Die Ostkirche war schon immer fasziniert von diesen frommen „Anachoreten“ (Einsiedlern im engeren Sinne im Unterschied zu den „Zönobiten“, die gleichfalls zurückgezogen, aber in klösterlichen Gemeinschaften leben): Schließlich waren die ersten Probanden dieser radikalen Form christlicher Selbstvervollkommnung in die Wüsten Syriens und Oberägyptens, die sogenannte Thebais gezogen – was übrigens in der Kunstgeschichte eine gleichnamige, sehr amüsante Bildgattung inspirierte: Vielfigurige Landschaftsbilder, in denen eine Masse von Einsiedlern sich in der meist recht idyllisch aufgefassten Wüstenei fast auf die Füße tritt – anscheinend konnte man zeitweilig daselbst an heißen Tagen hinter keinem Felsen Schatten suchen, ohne in eine christliche Klause hineinzuplatzen…

Allein, aber nicht einsam: Euthymius von Melitene, genannt der Große (377–473), lebte zusammen mit seinem Gefährten Theoktistus in einer Berghöhle, die sie für ihre Schüler als Kirche ausbauten. Unsere Miniatur den meditierenden Euthymius mit Gebetsbuch und Rosenkranz. Im Hintergrund schreitet Theoktistus, in fromme Lektüre vertieft, einher. Hinter ihm erstrecken sich die Gebäude der anwachsenden Klostergemeinschaft. Mehrere Mönche sind dabei, neue Hütten zu errichten.
Im Westen hatte man hingegen lange Zeit vor allem einzelne, herausragende Eremitenheilige verehrt – die große Büßerin Magdalena, die eine schön geschnittene Höhle mit malerischer Aussicht in der Provence bezog und dort von Engel gespeist wurde, oder den selbstquälerischen Kirchenvater Hieronymus, der in der glühenden Einöde die Bibel übersetzte – mit einem frommen Löwen als einziger Gesellschaft, dem er einst einen Dorn aus der Pfote gezogen hatte.

Keine allzu heiße Wüste hat Albrecht Dürer als Umgebung für den heiligen Hieronymus „im Gehäuse“ und seine große Hauskatze in seinem berühmten Kupferstich imaginiert, der die Vorlage für diese farbige Kopie des frühen 17. Jh. bot, die Maximilian I. für seine Miniaturensammlung erwarb.
Ein stark zunehmendes Interesse am Leben und Tun der Einsiedler ist ab dem 16. Jahrhundert im Gefolge des Konzils von Trient (tagte zw. 1545-63) zu bemerken. Bedrängt vom Protestantismus hoffte die neue innerkatholische Reformbewegung, in frühchristlichen Formen gottgefälliger Existenz Inspiration für die Gegenwart zu finden.
Vor diesem Hintergrund stellte ab 1585/86 die berühmte niederländische Kupferstecherdynastie Sadeler ein erfolgreiches Publikationsprojekt für den internationalen Bildermarkt auf die Beine: Vier Kupferstichserien mit Darstellungen von bis dato oftmals nur regional verehrten Einsiedlern, Klausnern und Eremiten, deren Vorlagen der flämische Maler Marteen de Vos (1532–1603) lieferte. Den Anfang machte die Folge »Solitudo sive Vitae Patrum Eremicolarum […]«., also etwa „Die einsame Wildnis oder Lebensbeschreibungen der Einsiedler“. 1594 folgten die ähnliche klangvollen »Sylvae Sacrae […]«, die „Heiligen Wälder“, in denen auch Einsiedler aus neuerer Zeit vorgestellt wurden. Im Folgejahr gab Jan Sadeler in Venedig dann »Trophaeum Vitae Solitarae […]« („Schätze/Ehrenzeichen des einsamen Lebens“) heraus. Den Abschluss bildete im Jahr 1600 die Folge »Oraculum anachoreticum […]«.
Die ebenso fromme wie ökonomische Rechnung der Sadeler ging voll auf: Ihre graphischen Serien erwiesen sich als großer Erfolg und fanden weithin Verbreitung – dies belegen nicht zuletzt die Gouachen, die im Residenzmuseums betrachtet werden können und die nichts anderes sind, als getreue, farbige Kopien der schwarz-weißen Kupferstiche.

Das Titelblatt der „Sylvae Sacrae“ bringt viele Aspekte des neuen „Eremiten-Booms“ auf den Punkt: Allegorien des Gebets und der Buße vor dem Hoffnungszeichen des Kreuzes, das sich über den Symbolen des Todes und der Vergänglichkeit erhebt. Im Hintergrund erscheint Christus, der als erster Eremit 40 Tage in die Wüste zog und dort vom Teufel – vergeblich – in Versuchung geführt wurde.
Dies muss nicht verwundern, denn zahlreiche Fäden verbinden die vier Bildfolgen mit den bayerischen Wittelsbachern: Schon die »Sylvae Sacrae“ hatten die Sadeler 1594 in München herausgegeben und dem regierenden Herzog Wilhelm V. „dem Frommen“ (1548-1626) gewidmet, einem großen Exponenten der Gegenreformation und eifrigen Förderer des Jesuitenordens. Optimistisch (und lateinisch) versicherte diesem das Widmungsgedicht „Die frühere Frömmigkeit kehrt wieder, heller Glanz tritt wieder in die Brust“. Später sollten Raphael Sadeler und sein Sohn im Auftrag von Wilhelms Nachfolger Maximilian I. noch dessen großes Buch- und Propagandaprojekt, die „Bavaria Sancta“ (eine mehrbändige Sammlung von bajuwarischen Heiligenviten), mit großformatigen Kupfern illustrieren.

Frommer Baulöwe: Wilhelm V. (reg. 1570-1597)
Es waren dann auch der Münchner Hof und seine Nebenresidenzen, wo sich bereits Ende des 16. Jahrhunderts eine Imitationsform vorbildlicher Weltflucht ausbildete, die bis weit ins Zeitalter des Rokoko hinein in ganz Europa kreative Blüten treiben sollte: Die aristokratischen „Eremitagen“ – etwas abgelegene, manchmal in eine künstliche Wildnis hineingebaute, aber mit allem Luxus ausgestattete Rückzugsorte der „happy few“. Dort konnten der Fürst und ausgewählte Mitglieder seines Hofstaats die Abkehr von allem Irdischen zelebrieren, abseits aufreibender zeremonieller und höfischer Pflichten zu innerer Einkehr gelangen und religiösen Übungen obliegen. Theoretisch zumindest – so manches Mal reiste natürlich auch die Mätresse zu den courtoisen Exerzitien an.
Früher Förderer dieses Phänomens war wiederum Wilhelm V., dem man lockere Umtriebe allerdings kaum unterstellen darf: Bis heute verwahrt der Kirchenschatz von St. Michael härene Bußhemden aus quälend kratzigen Textilien, die der stets um sein Seelenheil fürchtende Wittelsbacher unter seiner höfischen Tracht anzulegen pflegte, um sein sündiges Fleisch vorgreifend zu bestrafen – allerdings in stilvollem Ambiente:

Das „alte“ Schloss Schleißheim ließ Wilhelm V. als Mustergut und Altersresidenz errichten – später wurde der Bau durch seinen Sohn Maximilian I. noch einmal umfassend überformt.
Noch während auf den Pressen der Sadeler die letzten Abzüge ihrer Eremitenfolgen trockneten, hatte der fromme, aber schlecht wirtschaftende Herzog 1597 angesichts unübersteigbarer Schuldenberge abgedankt und gab künftig Geld als Privatier aus: Neben seiner geliebten Jesuitenkirche im Zentrum Münchens errichtete er sich eine weitläufige, klosterähnliche Altersresidenz, die „Wilhelminische Veste“ (später nach seinem Enkel als „Maxburg“ bezeichnet). Zusätzlich ließ er die von ihn erworbene Schwaige Oberschleißheim zu einer Art Mustergut und ländlicher Villa nach italienischem Vorbild ausbauen.
In diesen beiden Besitzungen des abgedankten Herrschers fanden jeweils gleich mehrere, künstlich angelegte und raffiniert ausgestattete Einsiedeleien Raum: Ein ganzer Gartenhof der Münchner „Veste“ war als eine von dunklem Nadelgehölz beschattete „Wildnis“ gestaltet. In ihrem Zentrum erhob sich ein künstlicher Grottenberg mit Einsiedlerhöhle, die Wilhelms Augsburger Kunstagent Philipp Hainhofer 1611 besichtigen durfte und beschrieb: „Die Grotta, so in disem newen Baw, ist von rechtem Felsen zusammen gemacht, mit eingehauenen Zellen, mit Dannen vnd wilden Baümen besetzt, quilt ein Wässerlin auss dem Felsen herauss […]. Im Bächlein wie das Wasser heraussquillet, ligen in Bley gegossene Schlangen, Eidexen, Krotten, Krebs und der Suppelex [= Hausrat] in diser Grotta ist alles nur von Bast, Stro, Raiss vnd Steckhen zusammengeflochten, der Altar von Felssen […]“.

Wilhelms Entscheidung, sich als Herrscher aus der Welt zurückzuziehen, hatte fromme Vorbilder: Diese Miniatur stellt die große Wende im Leben des mährischen Fürsten Svatopluk I. (lateinisch: Suatocopius, 840–894) dar, wie sie die Legende überliefert: Nachdem er in der Schlacht dem Kaiser Arnulf unterlag, richtete er seine Hoffnungen nur noch auf das Jenseits. Bestärkt wird er von Einsiedlern, denen sich der gestürzte Herrscher anschließt. Erst nach seinem Tod wird er als einstiger König erkannt und Kaiser Arnulf (an den heute noch sein kostbarer kleiner Reisealtar in der Schatzkammer der Residenz erinnert) lässt den einstigen Gegner und heiligen Einsiedler ehrfurchtsvoll bestatten.
Noch weitaus umfänglicher gestaltete sich das höfische Eremitentum in der moorigen Ebene um die Schleißheimer Villa: Hier hatte Wilhelm mehrere im Umkreis liegende Kapellen erworben und zusätzlich weitere neu errichten und jeweils mit Behausungen für einen oder mehrere Klausner ausstatten lassen. Schließlich umgab ein ganzer Kranz von fußläufigen Einsiedeleien den ländlichen Alterswohnsitz des Herzogs (der natürlich gleichfalls über eine eigene, dem heiligen Eremiten Wilhelm von Malavalle gewidmete Schlosskapelle verfügte).

In dieser Miniatur sind gleich zwei fromme Klausner namens Wilhelm miteinander verschmolzen: Der Titulus nennt den hl. Herzog Wilhelm von Aquitanien, Patron der Waffenschmiede, ruhmreichen Heerführer unter Karl dem Großen und Vorbild für das Versepos „Willehalm” des Wolfram von Eschenbach. 806 trat er als Laienbruder in seine eigene Klostergründung ein, die heutige Abtei Saint-Guilhem-le-Désert. Zugleich sind Helm und Kettenhemd unter der Kutte des Eremiten die Attribute des hl. Wilhelm von Malavalle, der sich nach einem kriegerischen Leben auf päpstlichen Rat in die Einsamkeit zurückzog. Diesem Wilhelm war auch die Schleißheimer Schlosskapelle gewidmet.
Nach dem Vorbild der römischen Stations- und Hauptwallfahrtskirchen konnten sie im Laufe eines Tages „abgepilgert“ werden. Fast jedes der kleinen Gotteshäuser verfügte dabei über ebenso raffinierte wie überraschende „Features“ der modischen Automaten-Technik, die diese Stätten frommen Rückzugs unentwirrbar mit der höfischen Ausstattungs- und Gartenkunst verbanden (wiewohl nicht immer geschmackssicher): In der Kuppel der Margaretenkapelle kreisten automatische Engeln auf Wolken um die zentrale Figur des heiligen Michael. In der Franziskuskapelle reckte eine lebensgroße Figur des Heiligen ihre Arme dem Kruzifix entgegen, von dem rote Fäden ausgingen und das Blut der Wundmale symbolisierten, die der visionäre Ordensgründer empfing. Eine weitere Franziskusfigur im Freien fungierte als Brunnenschmuck, aus deren Stigmata Wasser tropfte, das angeblich gegen Augenleiden helfen sollte…
Etwas harmloser war der Brunnen der Korbinians-Kapelle gestaltet, in den Wasser regengleich aus einer großen Glaskugel plätscherte. Im Inneren des Kirchleins entpuppten sich die Wachskerzen als maskierte Orgelpfeifen, aus denen Melodien ertönten!

Der heilige Einsiedler Jodokus war der Überlieferung zufolge ein bretonischer Prinz, der die Krone mit dem Pilgerstab vertauschte. Im nach ihm benannten Wald Saint Josse errichtete der Einsiedler eine Petrus und Paulus geweihte Kapelle. Die Miniatur zeigt ihn in Anbetung der Apostelfürsten. Reliquien des Jodokus gelangten 1338 in die Kirche St. Jodok im bayerischen Landshut. Dies dürfte den Heiligen für Münchner Wittelsbacher interessant gemacht haben, die Landshut im 16. Jh. als Nebenresidenz nutzen. Zusammen mit dem Apostel Jakobus wird Jodokus als Patron der Pilger verehrt. Im Mittelalter galt: „Wem Sant Jago (also der spanische Wallfahrtsort Santiago de Compostela) zu weit ist, der geht nach Saint Josse!
Die Einsiedler, die all diese künstlichen Einsiedeleien bewohnten und den liturgischen Betrieb der angeschlossen Kapellen gewährleisteten, waren teils Mitglieder unterschiedlicher Mönchsorden, teils handelte es sich um Nutznießer früher Formen von ABM, mit denen z. B. invalide Soldaten versorgt wurden – wobei über die jeweilige Eignung zum frommen Klausner-Leben heute nur noch spekuliert werden kann…
Leider sind von diesen ebenso originellen wie charakteristischen Kunstwelten aus den heißen Jahrzehnten der Gegenreformation heute nur noch wenige, verstreute Fragmente übriggeblieben. Doch geben zumindest die Gouachen des Residenzmuseums einen Eindruck von der Faszination, die sie für die Menschen des 17. und auch noch die des 18. Jahrhunderts besessen haben müssen: Von letzterer kündet heute noch eindrucksvoll die als künstliche Ruine gestaltete Eremitage des Nymphenburger Schossparks, die Wilhelms Urenkel, Kurfürst Max Emanuel (reg. 1679-1726) errichten ließ – die idyllische Magdalenenklause, an deren dunkel getäfelten Wänden übrigens Sadelers Eremiten-Kupferstiche hingen.

Gut verborgen im Nymphenburger Gehölz – die als künstliche Ruine gestaltete Magdalenenklause mit ihrer grottenartigen Kapelle
Unsere farbigen Miniaturkopien zierten hingegen, vielleicht als fromme Mahnung inmitten des höfischen Trubels? – im 18. Jahrhundert das Appartement der Kurfürstinnen in der Münchner Residenz.

Der heilige Fiacrius kombiniert in seiner Eremitage Frömmigkeit und Gartenkunst.