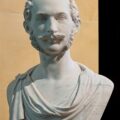„GERECHT UND BEHARRLICH“ dröhnt es in stuckierten Großbuchstaben hoch über den Stufen der prächtigen Gelben Treppe am Portal, das Unerschrockene in die einstigen Wohngemächer König Ludwigs I. (reg. 1825-1848) führt. Als Türwächter gewähren die im Jahr 2020 aufwendig rekonstruierten Plastiken eben jener personifizierten Herrschertugenden Einlass, nämlich die baumlangen Damen „Justitia“ und „Perseverantia“. Doch jenseits der so pompös in Architektur übertragenen Regierungsmaxime des gleichermaßen schwerhörigen wie autoritären Bayernherrschers geht es in diesen Tagen deutlich stiller und zurückgenommener zu: In dämmrigem Zwielicht erscheinen kleinformatige Gemälde und Graphiken, eine Art Hausaltar und eine Versammlung bronzener Büsten, die mit metallischem Blick den Eintretenden fixieren. Darüber schwebt an der Wand eine weitere, aber ganz anderslautende Devise: „Erkenne Dich selbst!“
Tatsächlich sind die hier versammelten rund 25 Kunstobjekte nicht Relikte aus der Ära Ludwigs I., des Bauherrn dieser Räumlichkeiten, sondern sie entstammen der Regierungszeit seines ältesten, 1811 geborenen Sohnes und Nachfolgers im Herrscheramt: Maximilian II., der nach der Abdankung seines Vaters im tumultösen europäischen Revolutionsjahr 1848 für gut eineinhalb Jahrzehnte den Thron bestieg – bis er schon 1864, nur wenige Monate nach seinem 53. Geburtstag vor nun etwas über 160 Jahren, starb.
In der allgemeinen Wahrnehmung fällt der arme Maximilian gegenüber seinem durchsetzungsstarken und kunstpolitisch daueraktiven Vater Ludwig I. einerseits, sowie seinem eigenen Sohn, dem unerreicht populären „Märchen-Kini“ Ludwig II. andererseits, oft hinten runter. Wer der aufgesockelte Schnurrbartträger aus grüner Bronze im Zentrum der Maximilianstraße, Münchens Edelmeile, denn nun ist, fragen sich wohl häufiger Stadttouristen wie Einheimische. Dass der dauernd kränkelnde, im persönlichen Umgang offenbar schwierige Mann ein skrupulöser, persönlich bescheidener Pflichtmensch war, dem nichts weniger lag als royale Dauerselbstdarstellung, macht es für Publikum wie Biographen bis heute nicht leichter. Dabei handelt es sich beim genaueren Hinsehen bei diesem dritten bayerischen König um eine besonders vielseitig interessierte Herrschergestalt, der sein Land in einer bewegten Phase sozialer wie politischer Umbrüche und vor dem Hintergrund umfassender Modernisierungstendenzen regierte.

Münchner „Maxmonument“, Kaspar von Zumbusch (Entwurf) und Ferdinand von Miller (Bronzeguss), 1865-1875
Grund genug also, diesem wenig bekannten Bewohner unseres Königsbaus in den Räumen, die er nach dem erzwungenen Auszug seines abgetretenen Vaters 1848 bezog, eine kleine Sonderpräsentation zu widmen. Sie thematisiert das wohl interessanteste, wiewohl leider lange verlorene Raumkunstwerk, das Maximilian II., ein Herrscher im Zeichen des Historismus, in seiner Residenz gestalten ließ! Denn schon kurz nach seinem so unerwartet erfolgten Regierungsantritt auf den Flügeln der Revolution und des Lola Montez-Skandals verwirklichte der neue Herrscher ein schon länger geplantes Bauprojekt: Ab 1850 ließ er den vom Vater geerbten Hofbauintendanten Leo von Klenze im Stockwerk über den Königsbau-Wohngemächern sein „Allerheiligstes“ oder „Sanktuarium“ einrichten, einen nur Wenigen bekannten, sorgsam ausgestatteten Rückzugsraum auf den Dächern der Residenz. An diesem abgeschotteten Ort innerer Einkehr und Gewissenserforschung umgab sich der mit ewigem Selbstzweifel kämpfende Maximilian mit Historienbildern exemplarischer Herrschertaten sowie mit Büsten vorbildlicher Staatsmänner und Philosophen. Vor ihrem Urteil und inspiriert durch ihr Beispiel pflegte er Lebens- und Regierungsfragen abzuwägen und zu rechtfertigen – wiewohl vielfach endlos und zum Ärger seiner Berater manches Mal ohne Ergebnis. Das (selbst)erzieherische Bildprogramm ergänzten Sinnsprüche an den Wänden, die zu tugendhaftem Handeln und Selbstdisziplin ermunterten.
Der gedankliche Kern dieser bereits vom Kronprinzen Max intensiv beplanten und als König dann rasch realisierten Ausstattung war die Deutung der Geschichte als einer schöpferischen, sinnstiftenden Macht – einer objektiven Kraft, deren ewige Gesetze zu erkennen und zu befolgen waren. Zugleich propagierte das Bildprogramm eine mystische Dimension des Königtums, die Maximilian II., obwohl säkulares Oberhaupt eines modernen Verfassungsstaats, dennoch besonders bedeutungsvoll schien:

Wilhelm von Kaulbach (1804-1874): Apotheose eines guten Herrschers, Öl auf Leinwand, München, 1851, Bayerische Staatsgemäldesammlungen
Den zentralen Blickfang und zugleich das teuerste Kunstwerk des Sanktuariums bildete ein Gemälde des führenden Münchner Historienmalers Wilhelm von Kaulbach, das isoliert vor einem der Fenster aufgestellt, als sinnstiftender Kommentar zu einem gegenüber angebrachten Bilderzyklus diente: Letzterer stellte anhand historischer Beispiele die Tugenden der Wittelsbacher Herrscher vor. Kaulbachs Leinwand hingegen zeigte den himmlischen Lohn solcher vorbildlichen Regenten: Aus dem Grab, unter dem sich die besiegten Todsünden winden, erleben sie den Aufstieg in die göttliche Sphäre und in den dort versammelten Kreis heiliger Monarchen. Mit Absicht orientierte sich Kaulbachs Komposition an Altarbildern der Renaissance, die biblische Himmelfahrtszenen zeigen, sowie an Peter von Cornelius‘ Fresko des „Jüngsten Gerichts“ in der Münchner Ludwigskirche. Spezifischer verweist das Kostüm des seligen Königs auf die Tracht des Wittelsbacher Hubertusordens – mithin auf dessen Großmeister: Maximilian II.!
Eine solche Vermischung von Königtum und Religion beruhte auf älteren Vorstellungen, die den Herrscher als obersten Priester verstand: Er ist der göttlich eingesetzte, Gott allein verantwortliche Mittler zwischen Welt und Himmel an der Grenze von Geschichte und Ewigkeit. Es ist vor allem dieser Aspekt eines neuen, allen Modernisierungstendenzen zum Trotz behaupteten Gottesgnadentums, das einige Jahre später wiederum leidenschaftlich von Maximilians Sohn und Nachfolger König Ludwig II. aufgegriffen wurde: In seinen berühmten Schlossbauten setzte er es kunstvoll – wiewohl fern abseits jeglicher Übertragung in reale Politik – in Szene.
Maximilian II. – König im Zeitalter des Historismus

Erkenne Dich selbst! – Eine „geschichtsträchtige“ Sammlung von Büsten und Bildern
Leider ging genau diese wandfeste Ausstattung des Sanktuariums zusammen mit der Raumschale 1944 im Bombenhagel, der große Teile der Residenz zerstörte, unter. Heute befinden sich an Stelle des königlichen Allerheiligsten Räumlichkeiten der Akademie der Schönen Künste, die 1972 das wiederhergestellte zweite Obergeschoss des Königsbaus bezog. Erhalten blieben jedoch kriegsversehrte Teile der ursprünglich 33 Köpfe umfassenden Büstensammlung historischer Persönlichkeiten sowie Skizzen und Entwürfe des einstigen Bildprogramms, die wir nun ein Stockwerk tiefer, aber in relativer Nähe ihres einstigen Standorts präsentieren. Sie können uns Lage, Bau und Gestaltung dieses einstigen „Sakralraums Wittelsbacher Historie“ vergegenwärtigen:

Auf diesem historischen Plan von 1839, der die verschiedenen Stockwerke des Königsbaus zeigt, ist der Standort des späteren Sanktuariums im östlichen zweiten Obergeschoss markiert
Als Standort seines „Sanctuaire d’études“ hatte Maximilian II. den östlichen Abschluss im zweiten Obergeschoss des Königsbaus bestimmt, an das sich jenseits einer mit Orangenbäumen bestückten Dachterrasse bald sein neu errichteter Wintergarten anschließen sollte. Im März 1851 erhielt Klenze den Planungsauftrag für dieses zwischen Himmelsgärten gelegenen Refugium. Im Folgejahr kam der Ausbau zu einem provisorischen Abschluss. Der Platz für das nur eine Fensterachse breite, aber immerhin etwa 12 x 6 Meter messende „Allerheiligste“ wurde durch die Verkürzung des westlich angrenzenden „Blumensaals“ Ludwigs I. gewonnen, in dem bei Hoffesten gespeist wurde. Der Zutritt erfolgte durch ein nördlich gelegenes Vorzimmer oder unmittelbar aus dem Königsappartement über eine Privattreppe hinter Maximilians Ruhezimmer, das etwa unter dem Sanktuarium lag (heutiger Raum 125). Ein in der Staatlichen Graphischen Sammlung erhaltener Wandaufriss Klenzes, der bereits viele Gestaltungsdetails zeigt, die in der schriftlichen Überlieferung des Raums dokumentiert sind, vermittelt uns einen Eindruck. Klenze, der sich nach jahrzehntelanger Arbeit für seine Hass-Liebe Ludwig I. diesem Auftrag des Sohnes eher gelangweilt unterzog, lieferte einen Entwurf, der in vielerlei Hinsicht an seine älteren Vorschläge für die ludovizianischen Denkmalprojekte, namentlich die Walhalla und die Ruhmeshalle, erinnert.
Im Zentrum des stuckierten Deckengewölbes erscheint das christliche Kreuz, umgeben von Sphinxen als Symbolen der Weisheit und des Mysteriums. Darunter zeigt die Längswand hinter den gereihten Büsten noch die zunächst anvisierte Verkleidung in Stuckmarmor, die jedoch aus Kostengründen durch Holztäfelungen ersetzt wurde. Die skizzierten Wandgemälde sind im antikisierenden Reliefstil gehalten. In der späteren Ausführung traten historistische Kostümszenen an ihre Stelle. Inmitten des klassizistischen Dekors dürften sie als Fremdkörper gewirkt haben – ähnlich wie die nazarenischen Fresken der Königswohnung, deren Ausführung der erboste Klenze zwanzig Jahre zuvor nicht hatte verhindern können. Über dem rechts gezeichneten Portal wacht der später durch Max von Widnmann modellierte „Genius des Studiums“ über die königlichen Geschichtsmeditationen.
Das Hauptinventar des Sanktuariums, Maximilians II. Sammlung von 33 Porträtbüsten, wurzelt letztlich in der Ideenwelt der Aufklärung, in dem darin propagierten Geniekult sowie der Literaturströmung der Empfindsamkeit, die Gefühl und moralische Betrachtung zusammenband. Bald begann zunächst der liberale englische Landadel patriotische Monumente in Form gruppenweise aufgestellter Büsten oder Statuen verdienstvoller Persönlichkeiten zu errichten. Diese Anlagen wirkten später vorbildhaft für die Denkmalprojekte des jungen Ludwig I. und – vermittelt durch diese – auch noch für das Münchner Sanktuarium.
Während aber der nationalstolze Ludwig in seinen öffentlich ausgestellten Büstensammlungen praktisch ausschließlich Vertreter „teutscher Zunge“ mit starkem bayerischem Übergewicht vereinte, erstreckte sich Maximilians II. Auswahl über die engen Grenzen Bayerns und D(T)eutschlands hinaus (wobei natürlich auch hier heimische Herrscher in rauen Mengen und per Amtsbonus Aufnahme fanden: Karl der Große, Otto I., Barbarossa, Karl V. …). Zugleich umfasste die Kollektion Persönlichkeiten von der Antike bis in die Gegenwart, reichte vom großen Alexander bis zum neuen „Olympier“ Schiller. Insgesamt erwies sich das zusammengestellte Panorama von Perikles über Mark Aurel bis zum heiligen König Ludwig IX. zwar überwiegend als konventionell und voraussehbar. Doch fallen im Vergleich mit den väterlichen Personenlisten auch eigene politische Akzente Maximilians II. auf, die sich von den Vorlieben seines im Alter im reaktionärer agierenden Vorgängers absetzen. Neben persönlichen „Lieblingen“ wie seinem verehrten Lehrer Schelling umgab sich der Sohn so in Momenten der Entscheidungsfindung mit Büsten von Staatsmännern, die eine liberale Politik vertraten, wie dem englischen Staatsmann William Pitt, mit Philosophen, die Demut und Ausgleich predigten, aber auch mit stark kontrovers beurteilten Persönlichkeiten wie Napoleon – Ludwigs I. Hassfigur schlechthin!

Der „Teufel“ Bonaparte, noch ein Franzose (der „Bon Roi“ Henri IV.), ein Preuße (Friedrich II. „der Große“) und ein englischer Liberaler (Prime Minister William Pitt) – so hätte sich Ludwig I. eine ideale Versammlung von Geistesgrößen kaum vorgestellt…
Dieses Nebeneinander von Rückgriff auf und Abkehr vom väterlichen Vorbild spiegelt auf faszinierende Weise das zeitlebens hochproblematische Verhältnis Maximilians zu seinem Erzeuger. Zahlreiche Passagen in seiner handschriftlich überlieferten Autobiographie belegen, ähnlich wie viele Briefstellen in Ludwigs Korrespondenz, das weitgehend lieblose, oft auch intrigante Miteinander des alten und des neuen Königs (und küchenpsychologisch folgerichtig sollte Maximilian diese gestörte Beziehung später auf seinen eigenen Sohn und Nachfolger Ludwig II. übertragen). Kulturpolitisch jedoch verband beide Wittelsbacher ein gemeinsamer Zugriff auf geschichtliche Zeugnisse als ein Mittel, ihre schwankende Herrschaft zu befestigen. Beide verehrten den Philosophen Schelling, einen Hauptvertreter des deutschen Idealismus, der Geschichte als „Spiegel des Weltgeistes“ begriff. Maximilian II. ließ sich zudem durch Leopold von Ranke unterrichten, einem Gründervater der modernen Geschichtswissenschaft, die zeigen möchte „wie es gewesen ist“. Rankes Forderung „aus dem Besonderen zum Allgemeinen aufzusteigen“ spiegelte sich im Sanktuarium seines Schülers: Aus den historischen Beispielen, die ihm in Büsten und Gemälden entgegentraten, wollte Maximilian allgemeine staatsphilosophische Grundsätze ableiten. Ergänzt wurde dies mit den entlang der Wände aufgemalten Sinnsprüchen – teils religiöse, teils hausväterliche Lehren, die als Leitsterne der königlichen Gewissenserforschung fungierten. Dabei stehen altbekannte, der Bibel, den Kirchenvätern und antiken Moralisten entnommene Maximen neben kindlichen Merkversen, deren flache Banalität erschreckt – zumindest im geheimen Think Tank eines Staatsoberhaupts. Diese übrigens keinesfalls überstürzte, sondern lang und vielfach überdachte Auswahl eröffnet mithin interessante Einblicke in Maximilians Denken, seine literarische und gefühlsmäßige Prägung: Auffällig sind die zahlreichen Ermahnungen, die Lebenszeit richtig zu nutzen – hier scheint der König selbst ein Problem erkannt zu haben, das seine Zeitgenossen als ein ewiges Schwanken und Hinauszögern von Entscheidungen kritisierten.
Königliches Selbstzeugnis und Symbol einer Epoche

Sein kulturpolitisches Lieblingsprojekt, ein Bayerisches Nationalmuseum, ließ Maximilian II. ab 1858 programmatisch in dem neuen historistischen Mischstil errichten. Für die Innengestaltung gab der König einen vielteiligen Zyklus landesgeschichtlicher Wandgemälde in Auftrag, deren Themen teilweise auch im Bildprogramm des Sanktuariums auftauchen
Die Ausstattung des Münchner Sanktuariums vereint so zwei Sphären: Die private Seelenwelt des zweifelnden Menschen Maximilian und die des Königsamtes, das auf Tradition und Pflicht ruht. Schwankend zwischen Psychologie und Repräsentation erweist sich das verschwundene Raumkunstwerk speziell in dieser Ambivalenz als charakteristisches Epochendenkmal des 19. Jahrhunderts. Tatsächlich zieht es in erster Linie aus dieser Zwiespältigkeit seinen Reiz und nicht primär aus der Originalität seiner Konzeption (so originell war die nicht). Und sicher nicht aus der künstlerischen Vollendung: In ästhetischen Fragen war Maximilian II., wie auch sonst, deutlich unsicherer als sein kunst- und architekturverliebter Vater, zugleich weniger visionär und unbedenklich als sein bauwütiger Sohn. Der halbgare, inkonsequente „Maximiliansstil“, den er so leidenschaftlich patronisierte, zeigt in seinen erhaltenen Beispielen bis heute anschaulich die Beschränkungen des königlichen Kunstwollens. Die von Maximilian beauftragten Büsten und Historienbilder sind, von einigen Ausnahmen sowie Kaulbachs Riesenleinwänden einmal abgesehen, mehr oder minder brave Dutzendware, die (kostengünstige) Jungtalente der Münchner Akademie als „Gesellenstücke“ lieferten – ähnlich hatte schon Ludwig I. die Ausmalung der Königsbauräume realisieren lassen: Die Anatomie stimmt, Geist hingegen fehlt öfters.
Aber das Sanktuarium ist nicht nur gebauter Ausdruck von Maximilians monarchischem Selbstverständnis gewesen, sondern zugleich auch ein charakteristisches Produkt des Historismus. Dies wird nicht zuletzt erkennbar in seiner selbstbewussten Einreihung in eine geschichtliche Tradition: Frühe Vorläufer hatte das Münchner Refugium in fürstlichen Studien- und Rückzugsräumen des späten Mittelalters wie dem „Estude du Roi“, das Charles V. (1338-1380) in Schloss Vincennes einrichtete. In der Renaissance gestalteten italienische Humanisten ihr „Studiolo“ bereits als programmatisches Gehäuse ihrer geistigen Welt und statteten es mit Kunstobjekten, Gelehrtenporträts sowie Symbolen der Vergänglichkeit und Selbstbefragung wie Uhr und Spiegel aus. Berühmtheit erlangte etwa das Kabinett des Federico da Montefeltro im Herzogspalast von Urbino mit seiner Porträtreihe berühmter Männer (um 1476).
Wenig später entstand in Mantua die „Grotta“ der Isabella d’Este (ab 1497) für ihre Skulpturensammlung und einem Studienraum darüber, den Mantegna mit allegorischen Gemälden schmückte. Einen Höhepunkt erlebte der Raumtypus schließlich im Studiolo des Großherzogs Francesco I. de’ Medici im Palazzo Vecchio in Florenz, das Giorgio Vasari mit Rätselbildern und Statuen dekorierte (1570/72). Unmittelbar inspiriert wurde Maximilians Allerheiligstes zudem, wie bereits vielfach angeklungen, durch die dynastischen und nationalen Denkmalprojekte Ludwigs I., namentlich die Regensburger Walhalla nebst der Münchner Ruhmeshalle mit ihren Büstensammlungen, oder die Arkaden und Kaisersäle am Hofgarten mit den bronzenen Herrscherstatuen und Freskenzyklen zur bayerischen und deutschen Geschichte.
So erweist sich das letztlich kurzlebige Sanktuarium Maximilians II. gleichermaßen verbunden mit den Persönlichkeiten und den Königsidealen gleich dreier Wittelsbacher Herrscher – Sohn, Vater und Enkel, mit den allgemeinen Zeitströmungen zur Mitte des „langen 19. Jahrhunderts“ und zugleich speziell mit der Münchner Kunstgeschichte zwischen Spätromantik, Restauration und Historismus. Möglichst viele seiner Facetten gleichberechtigt vorzustellen, haben wir nun anhand der in der Residenz erhaltenen Reste dieses untergegangenen Raumkunstwerks in unserem Saal 14a versucht – möglichst „gerecht und beharrlich“…