Rasch zu urteilen fällt uns oft leicht – zunehmend im gegenwärtigen Zeitalter schnell aufkochender medialer Empörung. Dabei ist ein gerechtes, zumindest abgewogenes Urteil zu treffen bekanntermaßen schwer, nicht zuletzt im Kultursektor! So wurde zum Beispiel die künstlerische Produktion, die Bayerns allseits geschätzter „Märchenkönig“ Ludwig II. (reg. 1864-1886) begeistert initiierte, abgesehen von seiner Wagner-Förderung lange Zeit als „monumentaler Kitsch“ kritisiert. Erst seit wenigen Jahrzehnten erfahren seine legendären Schlösser samt Ausstattung ihre ästhetische Rehabilitierung und werden heute als weltkulturerbeverdächtige Exzellenzbeispiele des internationalen Historismus gefeiert. Mit einem charakteristischen Erzeugnis dieser Kunst wollen wir uns in diesem Beitrag beschäftigen.
Es handelt sich um ein jüngst restauriertes Leinwandgemälde und gehört zu den raren Stücken, die nach der Kriegszerstörung von Ludwigs berühmten Wohnappartement hoch über dem Münchner Odeonsplatz im Frühjahr 1944 heute noch in der Residenz an den geheimnisvollen „Kini“ erinnern. Und wie es der Zufall passend will, handelt es sich just um die Darstellung eines der für die bildenden Künste wichtigsten Urteile in der (mythologischen) Weltgeschichte! Zwar ist es nicht das so oft dargestellte Urteil des trojanischen Prinzen Paris, der aus drei Göttinnen die Schönste zu wählen hatte. Wir sehen aber eine ähnliche Figurenkonstellation: Auch auf unserem Bild ist ein junger Fürst der Antike beschäftigt, Streit zwischen Frauen zu schlichten. Aber während die zwei unterlegenen Beauty Queens des Olymp das „Parisurteil“ zum Ausgangspunkt eines mörderischen Krieges machten, praktiziert auf der Münchner Leinwand der weise Salomo clevere Rechtsfindung entlang psychologischer Indizien. Der nach diesem dritten König Israels benannte Urteilsspruch sollte über Jahrtausende hinweg sprichwörtliche Gültigkeit behalten!
Das alttestamentarische „Buch der Chroniken“ überliefert die bekannte Geschichte von den zwei jungen Prostituierten, die jeweils einen Sohn haben und in einer WG zusammenleben. Als das eine Baby den Kindstod stirbt und nicht bestimmt werden kann, wer die Mutter des lebenden Knaben ist, fordern sie die Entscheidung vor dem Thron des klugen Herrschers, denn, so die Klägerin: ihre Gegnerin „stand in der Nacht auf und nahm meinen Sohn von meiner Seite und ihren toten Sohn legte sie in meinen Arm.“
Vertrackte Situation! Doch da Gott dem Salomo auf dessen Bitte hin einst die Herrschergabe der Weisheit verlieh, weiß der König Rat, wenn dieser auch zunächst schockiert: Er verlangt ein Schwert und spricht: „Teilt das lebendige Kind in zwei Teile und gebt dieser die Hälfte und jener die Hälfte. Da sagte die Frau – denn ihr mütterliches Herz entbrannte in Liebe für ihren Sohn: Ach, mein Herr, gebt ihr das Kind lebendig und tötet es nicht!“ So deckt Salomo die Wahrheit auf und die verzweifelte Mutter empfängt ihr Baby unbeschadet zurück.
Schon sehr früh fasste man das „Salomonische Urteil“ als Exempel königlicher Gerechtigkeit und göttlich legitimierter Herrscherqualität auf. In diesem Sinne wurde es, oft kombiniert mit ähnlichen Episoden aus Geschichte und Mythos, in Palästen und an den Stätten öffentlicher Rechtspflege dargestellt, meist im Auftrage eines Mächtigen, der sich (mit welchem Recht auch immer) als „neuer Salomo“ feiern ließ. Schließlich galten Schutz und Wahrung der Justiz als Kernaufgabe des Herrschers. Davon zeugen noch heute die barocken Bildprogramme der Münchner Residenz:

Die strahlende Gerechtigkeit gehört zu den vier „weltlichen“ Kardinaltugenden, die mit den drei „göttlichen“ Glaube, Liebe, Hoffnung einen symbolischen 7er-Katalog bilden
Ende des 16. Jh. ließ Herzog Wilhelm V. die personifizierte Gerechtigkeit im Kreis anderer Fürstentugenden gut sichtbar an die Wölbung des Antiquariums freskieren. Nur wenige Jahre später befahl sein Sohn Maximilian I. nicht nur, diese Darstellungen zu erneuern sowie einen eigenen „Saal des Rechts“ auszumalen, sondern er platzierte zudem Göttin „Justitia“ in Bronze gegossen über den Haupteingang seiner Residenz, direkt neben die dort thronende Muttergottes!

Die „Sonne der Gerechtigkeit“ leuchtet auf ihrer Brust! Heute wacht Justitia als Kopie am Residenztor, das Original steht geschützt in den „Bronzesälen“ am Kaiserhof
In Maximilians „Reicher Kapelle“ wiederum erscheint König Salomo persönlich gleich zweimal am prunkvollen Hauptaltar: Silberreliefs zeigen ihn mit dem umstrittenen Baby und beim Empfang der exotischen Königin von Saba, die anreiste, um die weithin bekannte Weisheit von Israels König zu ehren. In Fortsetzung solcher Bildtraditionen ließ noch eine Generation später Maximilians Schwiegertochter, die Kurfürstin Henriette Adelaide, in den 1660er Jahren ihr Audienzzimmer mit öffentlichkeitswirksamen Deckenbildern schmücken. Sie zeigen Beispiele tätiger, oftmals origineller Rechtsprechung, die antike Fürsten zugunsten ihrer einfach(st)en Untertanen übten.
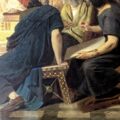



In mancherlei knüpft dqw historistische Kunstwollen der Pilotys in München und im Umfeld der Wittelsbacher an ältere Vorbilder an: Schon der Großvater Ludwigs II., König Ludwig I. (reg. 1825-1848), hatte seine Residenzstadt zu einem Zentrum monumentaler Historienmalerei gemacht, wie sie Anfang des 19. Jh. vor allem durch die Schule der „Nazarener“ betrieben wurde. Mit Peter von Cornelius und Julius Schnorr von Carolsfeld berief Ludwig I. deren namhafteste Vertreter als Lehrer an die Münchner Kunstakademie und deckte sie und ihre Schüler mit öffentlichen Aufträgen ein: Die Ausmalung der Hofgartenarkaden, des Königs- und des Festsaalbaus der Residenz mit Szenen aus der mittelalterlichen Heldensage, der bayerischen Landes- und der deutschen Reichsgeschichte. Die Nazarener huldigten in erster Linie einer idealistischen Kunstauffassung, die sich an der harmonischen Schönheit italienischer Renaissancemalerei orientierte. Sie schöpfen insofern ein Stück weit aus anderen Quellen als ihre Nachfolger, die Pilotys und deren Zeitgenossen.

Sitzt das Kettenhemd auch korrekt? Für die romanischen Hintergrundsarchitekturen seiner Nibelungenfresken wälzte Schnorr Nachschlagewerke und beriet sich mit Hofbühnenbildner Quaglio
Aber auch schon Schnorr und seine Schüler strebten im Ansatz nach einer authentischen Darstellung überprüfbarer historischer Bilddetails, sei es im Kostüm oder mit Blick auf ihre Architekturkulissen. Dies geschah nicht zuletzt auf Drängen des königlichen Auftraggebers, der beispielsweise verlangte, wenn zeitgenössische Porträts der dargestellten Persönlichkeiten überliefert waren, diese jeweils in aktuelle Bildkompositionen zu kopieren: Aus solch einer möglichst korrekten Wiedergabe des geschichtlichen Rahmens erhoffte sich Ludwig I., auch die historische Wahrheit der dargestellten dynastischen Heldentaten ableiten zu dürfen: Die von ihm geförderten Künstler sollten die in Jahrhunderten gewachsene Legitimität Wittelsbacher Herrschaft im Medium der Historienmalerei propagieren, gemäß der Ansage des Münchner Akademiedirektors Wilhelm von Kaulbach: „Geschichte müssen wir malen, Geschichte ist die Religion unserer Zeit, Geschichte allein ist zeitgemäß!“
Auch der Bilderschmuck im Residenzappartement Ludwigs II. mit Pilotys „Salomo“ kann als eine solche Manifestation säkularer Geschichts-Religion gelesen werden – und auf einmal erscheint biblischer Bombast nicht mehr als Fremdkörper, sondern als moderne Version der eingangs vorgestellten Herrschaftspropaganda in bewährter Wittelsbacher Tradition: 

Unbekannter Künstler: Karl Albrecht flieht aus der Münchner Residenz, ehemals im Appartement Ludwigs II.
Schließt Pilotys „Salomo“ im Verein mit den übrigen Historiendarstellungen der Königswohnung so an ältere gemalte Tugendkataloge innerhalb der Residenz an, darf doch auch die Bedeutung zeitgenössischer Kunst für diese opulente Bilderwelt nicht außer Acht gelassen werden. 

Täuschend echter Theaterprunk: Ein von Ludwig II. in Auftrag gegebenes Bühnenbildmodell der Versailler Spiegelgalerie
Hinsichtlich des Settings schwelgte nicht nur die Malerei, sondern auch das Theater des Historismus im Ausstattungs-Illusionismus. Exotische Opernsujets erfreuten sich bei Ludwig II. und seinen Zeitgenossen höchster Beliebtheit: Gounods „Königin von Saba“ (1862) oder Massenets „Roi de Lahore“ (1877) entzückten mit effektvollen Bühnenbildern, Wiederaufnahmen wie Méhuls „Joseph in Ägypten“ oder Rossinis „Mosè“ entführten die Zuhörer in biblische Welten und stellten ihnen Pilotys Bildkompositionen dreidimensional vor Augen. Einmal mehr ergibt sich der Bezug zum wenige Jahrzehnte später aufkommenden Historien- und Sandalenfilm, oder – zeitlich näher – zum gemalten Panorama, das den Betrachter in ein auf einen Rundhorizont gemaltes Geschichtsbild eintreten lässt. Als junger Mann hatte Piloty selbst an einem solchen Panorama der Stadt Jerusalem mitgearbeitet – vielleicht konnte er dabei Anregungen für seine spätere Darstellung des Salomonischen Palastes sammeln? 






